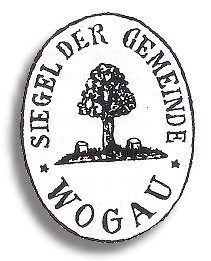Geschichte von Jenaprießnitz und Wogau
Jenaprießnitz
Die erste urkundliche Erwähnung ist für Jenaprießnitz aus dem Jahre 1252 belegbar, in der Urkunde, die Pfarrer Albrecht aus Prießnitz (Ortsname: slawischer Ursprung, einst auch: Briesenitz, Briseniz, Jehne-Brißnitz an der Gembde, als den Ort, wo es Birken gibt, „breza“ bedeutet Birke, Brezniza könnte Birkenhain, Birkenbach heißen) als Zeuge für Burggraf Dietrich von Kirchberg (Fuchsturm) genannt wurde.
1294 sagt sich Otto von Gleisberg von allen Rechten eines Gartens in Briseniz los, der der Kirche des Ortes, einer Marienkirche, übergeben wurde. 1306 war das Dorf ein Lehen der Burggrafen von Kirchberg mit Sitz auf dem Hausberg, die im Ort einen Edelsitz hatten. Die Reformation setzte sich in Jenaprießnitz um 1527 durch. Während des Dreißigjährigen Krieges vernichtete 1637 ein Großbrand große Teile des Ortes einschließlich Schule und Kirche, die dann bis 1644 wieder aufgebaut wurde. Die Orgel wurde allerdings erst 1855 durch den bekannten Rodaer (heute Stadtroda) Orgelbauer Adolph Poppe gebaut.
Seit 1764 gibt es in Jenaprießnitz ein Brauhaus, das noch heute (d.h. wieder, unter Regie des Brau- und Heimatvereines) Bier braut. Zwistigkeiten gab es zwischen den Orten Jenaprießnitz, Wogau und Ziegenhain immer wieder, meist ging es um strittige Ackerflächen. Die Feuerwehr wurde in Jenaprießnitz 1892 gegründet.
In den 1920er Jahren erfolgte durch Karl Herold in Jenaprießnitz die Gründung einer Süßmosterei und Weinkelterei, die nach 1940 durch seinen Schwiegersohn Karl Diedel weiterbetrieben wurde. Ab 01. Juli 1941, nun unter Gerd Diedel, arbeitete sie als Mineralwasserfabrik, in der auch Bier abgefüllt wurde. Ab 1972 erfolgte nur noch die Herstellung von Brauselimonade. Am 30. Juni 1990 wurde die Fabrik geschlossen.
Der Tanzsaal neben dem ehemaligen Gasthof ging 1959 in den Besitz der Gemeinde über. Heute ist der ehemalige Tanzsaal federführend durch den Saalverein wieder ein beliebtes kulturelles Zentrum für Jenaprießnitz und Wogau.
Im Jahre 1965 wurde dann Jenaprießnitz mit Wogau zu einem „Doppeldorf“ zusammengeschlossen.
Wogau
Für Wogau (einst auch Wachowe, Wachouwe, Wachau) ist die erste urkundliche Erwähnung aus dem Jahre 1259 mit der Auflage zum Zehnt durch Meinhardi de Wachowe an das Kloster Kapellendorf nachweisbar. 1406 erfolgte die Nennung von Weinbergen am Jenzig bei Wachouwe bzw. Wochow. Bis 1526 gab es in Wogau ein Klostergut, das dem Kloster Bürgel gehörte, jedoch im Zuge der Reformation dann zum Amt Bürgel kam. Später entstand daraus ein Rittergut, dem die meisten Wogauer Fluren gehörten.
Während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) war Geheimrat Bernhard Pflügk zum Posterstein Besitzer des Gutes, was in einem Schenkungsbrief von Herzog Johann Wilhelm von Sachsen-Jena (unter Regentschaft von Herzog Johann Ernst II. von Sachsen Weimar) 1683 Bestätigung fand. Nach mehrmaligem Besitzerwechsel wurde das Gut 1810 von der herzoglichen Kammer an die Gemeinde Wogau verkauft und parzelliert, so dass durch ansässige Familien einzelne Höfe entstehen konnten.
gewaltige Überflutung durch ein Hochwasser des Gembdenbaches nach einem Wolkenbruch ereignete sich in Wogau am 01. Juni 1859.
Gottlieb Wölfel gründete 1876 die alte Ziegelei, die unter verschiedenen Besitzverhältnissen bis 1963 arbeitete. 1893 wurde auch in Wogau eine Feuerwehr gegründet. Der noch heute tätige Pfingstverein geht auf sein Gründungsjahr 1911
zurück. 1965 wurde dann Wogau mit Jenaprießnitz zu einem „Doppeldorf“ zusammengelegt.
Jenaprießnitz/Wogau
Für die beiden Orte wurde 1969 ein Kindergarten gegründet, der sich nach durchgeführter Erweiterung auch heute noch großer Beliebtheit erfreut.
Am 01. Juli 1994 erfolgte dann die Eingemeindung des ehemaligen „Doppeldorfes“ Jenaprießnitz/Wogau in die Stadt Jena.
Nach einem langen Dauer- und Starkregen wurden am 28.09.2007 wiederum Teile des Ortes durch ein Hochwasser des Gembden- und des Gäderbaches heimgesucht. Die gemeinsame Feuerwehr von Jenaprießnitz/Wogau erhielt 2009 einen neuen, leistungsfähigen Stützpunkt.
Historische Hinweise zu Jenaprießnitz/Wogau im Ortsblatt
| Nr. 4, Oktober 2003 (Lieben Frauen Kirche in Briseniz) Sonderheft 04 |
| Nr. 6, März 2004 (Klostergut Wogau) Sonderheft 06 |
| Nr. 7, Juli 2004 (Wahlen vor 154 Jahren in Jenaprießnitz) Sonderheft 07 |
| Nr. 8, Oktober 2004 (Sintflut im Gembdental 1859) Sonderheft 08 |
| Nr. 9, Januar 2005 (Wissenswertes zur Orgel in Jenaprießnitz)Sonderheft 09 |
| Nr. 10, April 2005 (Eine alte Gemeindeausgebenrechnung von 1569 in Jenaprießnitz) Sonderheft 10 |
| Nr. 14, April 2006 (Heiligenfiguren der Kirche Jenaprießnitz und Reformation) Sonderheft 14 |
| Nr. 16, September 2006 (Über die alte Ziegelei in Wogau), (Napoleons Soldaten zogen durch Jenaprießnitz) Sonderheft 16 |
| Nr. 17, Januar 2007 (Diedels Brausefabrik) Sonderheft 17 |
| Nr. 19, Juni 2007 (Zum Lochbrunnen von 1847) Sonderheft 19 |
| Nr. 20, Oktober 2007 (Geschichte des Kindergartens Wogau) Sonderheft 20 |
| Nr. 22, März 2008 (Hochwasser Gembdenbach 2007), (2. Teil Ziegelei Wogau) Sonderheft 22 |
| Nr. 23, Juli 2008 (Gründung der Feuerwehren) Sonderheft 23 |
| Nr. 26, April 2009 (40 Jahre Kindergarten Wogau) Sonderheft 26 |
| Nr. 27, Juli 2009 Sonderheft] (Jahreis, Gerhard: Zur frühen Geschichte von Wogau; Ellenberg, Jürgen: Weitere Ortsgeschichte von Wogau)Sonderheft 27 |
| Nr. 31, Juli 2010 (die 1960/70 Jahre) Sonderheft 31 |
| Nr. 34, März 2011 (100 Jahre Pfingstverein Jenaprießnitz) Sonderheft 34 |
| Nr. 35, Juni 2011 (100 Jahre Pfingstgesellschaft Jenaprießnitz)Sonderheft 35 |
| Nr. 51, Juli 2015 (erste Erwähnung Jenaprießnitz 1252) Sonderheft 51 |
| Nr. 54, April 2016 (zum Soldatengrab des Andreas Mäder auf dem Jenaprießnitzer Friedhof) Sonderheft 54 |
Quellen
Ortsblätter Jenaprießnitz/Wogau (siehe oben)
Börner, Daniel: 250 Jahre Gemeindebrauhaus in Jenaprießnitz (Kleine Chronik zur Geschichte und Gegenwart), Hrg.: Brau und Heimatverein Jenaprießnitz/Wogau e.V., 2014
Historisches
In dieser Rubrik finden Sie eine Sammlung von historischen Bildern sowie interessanten historischen Begebenheiten und Fakten rund um Jenaprießnitz und Wogau, zusammengetragen und aufgeschrieben von Herrn Fridtjof Dossin.
Die einzelnen Beiträge erschienen in den Ortsblättern und sind hier nochmal zusammengefasst.
Wissenswertes über die Orgel der Kirche zu Jenaprießnitz
 Nachdem die Orgelklänge in der Kirche zu Jenaprießnitz am Heiligen Abend verklungen waren, hatte ich die Idee etwas über unsere Orgel zu schreiben. Nachdem 1637 die Kirche nebst Kirchhof, Schule und das Dorf oberhalb abgebrannt waren, wurde die Kirche mühselig bis 1644 wieder aufgebaut. Vorerst wurde 1647 ein Flavours Klavier für die neue Kirche gekauft. Wahrscheinlich war dieses Orgelklavier auch der Vorgänger der heutigen Orgel. 1855 wurde dann durch den Orgelbaumeister Adolph Poppe aus Roda (heute Stadtroda) eine neue Orgel gebaut. Die Familie Poppe aus Roda hat in vielen Generationen Orgeln gebaut, nachweislich der älteste ist Johann Christian Poppe, geboren 1726, gest. 1782. Unsere Orgel wurde von Adolph Poppe gebaut und der lebte von 1807 – 1885 im heutigen Stadtroda. Der Kostenvoranschlag und die technische Beschreibung der zu bauenden Orgel wurde am 21.12.1854 erstellt und die Orgel soll bis Michaeli (29. Sept.) 1855 fertig gestellt sein, Außerdem mussten zur Aufstellung der Orgel in der Kirche auch andere Baumaßnahmen erledigt werden. Die Orgel hat ein Manual und ein Pedal. Die technische Beschreibung lässt erkennen, daß Zinnpfeifen und Holzpfeifen aus Birnen- u. Fichtenholz verwendet worden. Die Registerköpfe sind mit Porzellan belegt worden, welche die Namen der Stimmen enthalten. Des weiteren sind 2 Windbälge vorhanden, die abwechselnd oberhalb der Orgel (Boden der Kirche) getreten wurden (heute mit Motor).
Nachdem die Orgelklänge in der Kirche zu Jenaprießnitz am Heiligen Abend verklungen waren, hatte ich die Idee etwas über unsere Orgel zu schreiben. Nachdem 1637 die Kirche nebst Kirchhof, Schule und das Dorf oberhalb abgebrannt waren, wurde die Kirche mühselig bis 1644 wieder aufgebaut. Vorerst wurde 1647 ein Flavours Klavier für die neue Kirche gekauft. Wahrscheinlich war dieses Orgelklavier auch der Vorgänger der heutigen Orgel. 1855 wurde dann durch den Orgelbaumeister Adolph Poppe aus Roda (heute Stadtroda) eine neue Orgel gebaut. Die Familie Poppe aus Roda hat in vielen Generationen Orgeln gebaut, nachweislich der älteste ist Johann Christian Poppe, geboren 1726, gest. 1782. Unsere Orgel wurde von Adolph Poppe gebaut und der lebte von 1807 – 1885 im heutigen Stadtroda. Der Kostenvoranschlag und die technische Beschreibung der zu bauenden Orgel wurde am 21.12.1854 erstellt und die Orgel soll bis Michaeli (29. Sept.) 1855 fertig gestellt sein, Außerdem mussten zur Aufstellung der Orgel in der Kirche auch andere Baumaßnahmen erledigt werden. Die Orgel hat ein Manual und ein Pedal. Die technische Beschreibung lässt erkennen, daß Zinnpfeifen und Holzpfeifen aus Birnen- u. Fichtenholz verwendet worden. Die Registerköpfe sind mit Porzellan belegt worden, welche die Namen der Stimmen enthalten. Des weiteren sind 2 Windbälge vorhanden, die abwechselnd oberhalb der Orgel (Boden der Kirche) getreten wurden (heute mit Motor).
Die Außenansicht der Orgel wurde in byzantinischen Baustil mit Bildhauerarbeiten dem inneren der Kirche angepasst. Die Orgel kostete laut Voranschlag 350 Thaler. Der Preis erhöhte sich durch einige Zusätze auf 355 Thaler.
Nun eine Abschrift einer Versammlung der Kirchengemeinde zu Jenaprießnitz zur Annahme des Angebotes von Herrn Orgelbaumeister Poppe aus Roda:
Jenaprießnitz, den 21. Januar 1855
Heute Nachmittag, 2:00 Uhr, hatten sich die Mitglieder der Kirchengemeinde sowie der Orgelbaumeister Poppe aus Roda in der Gemeindestube eingefunden um über den Bau einer neuen Orgel zu verhandeln. Es wurde hierauf unter Vorbehalt der Genehmigung der Großherzoglichen Kircheninspektion folgendes festgesetzt:
Außer der in der Disposition A (Voranschlag) aufgestellten Bedingungen wurde noch bestimmt:
- Der Orgelbaumeister Poppe entwirft zu den schon benannten Stimmen noch Quinter 3 Fuß in die Orgel zu hängen zu dem Preis von 5 Thalern.
- Der Orgelbaumeister Poppe übernimmt das Anstreichen der Außenwand der Orgel.
- Die Zahlung des Preises für die Orgel von nun 355 Thalern erfolgt nachdem dieselbe vollendet und von einem Prüfverständigen für gut befunden worden ist
Im Gegenteil ist die Gemeinde nicht verbunden die Orgel anzunehmen.
K. Elle
Jacob Meinhardt
Gottlob Trillhose
Adolph Poppe
Interessant ist noch aus dem Angebot folgendes:
- Ein Teil der Summe – also 100 Thaler – wurde bei Beginn des Aufstellens der Orgel gezahlt und der Rest von 255 Thalern nach vollendetem Bau und der „gehörigen Approbation“ – der Abnahme.
- Die Gemeinde Jenaprießnitz die neue Orgel sowie das Werkzeug mittels Pferdewagen aus Roda abzuholen hatte und die alte Orgel und das Werkzeug wieder nach Roda zu bringen war.
- 2 Gehilfen des Orgelbaumeisters bekamen ca. 7 Wochen freie Beköstigung und Logie.
- Die Garantie beträgt 12 Jahre.
- Prüfverständiger war G. Töpfer aus Weimar.
Nun spielt unsere Orgel fast wieder 150 Jahre – eine kleine Reparatur bekam Sie 1905 – nun bekommt sie sehr schlecht Luft. Eine Überholung muß in den nächsten Jahren erfolgen, aber es fehlt noch an Geld. Vielleicht habe ich einige Nachbarn begeistert.
F. Dossin – nach Beilage Jenaer Volksblatt 1909
Erinnerung an die Gembdental-Sintflut 1859
Am 1. Juni 1859 ging auf der Wöllmisse zwischen Großlöbichau und Schöngleina ein mächtiger Wolkenbruch nieder. Völlig überraschend für die Einwohner von Wogau, wo Regen kaum zu spüren war, schwoll der Gembdenbach zu gewaltiger Höhe an. Die Wassermassen traten über die Ufer und überfluteten das Gembdental einschl. der Landstraße (heutige B 7). An einem der ersten Häuser Wogaus der alten „Einnahme“ (heute Gehöft Raitzsch) war noch vor Zeiten eine Marke angebracht, durch welche man sich von der enormen Fluthöhe überzeugen konnte. Die Höhe der Marke war zwischen 1,20 m und 1,50 m über OK Straße. Der Gembdenbach ist in normaler Zeit ein kleiner Bach der schnell fließt. Folgendes zum Vergleich:
Die Saale hat in der Jenaer Gegend ein Gefälle von 1:1000. Der Gembdenbach von Wogau bis zu seiner Mündung nahe der Brücke nach Kunitz 1:50, also 20 x mehr. Wer die rasende Geschwindigkeit der Saale bei dem Hochwasser 1994 beobachten konnte, muß sich vom wilden Dahinstürmen der Flut des Gembdenbaches 1859 eine entsprechende Vorstellung machen können. Man begreift aber auch, daß in der Breite der Flut gewaltige Veränderungen am natürlichen Gelände und an den Bauten geschehen sind. Es wird berichtet, daß die Wogauer „Einnahme“ im Jahre 1859 im Neubau begriffen war. Vor ihr stand am 1. Juni ein Wagen mit behauenen Kalkbruchsteinen. Der Wagen kam ins Wanken, die Steine zum Teil 5 Zentner schwer, kamen in die Flut. Die Flut wälzte sich talabwärts zur Saale und nahm die Steine bis in das zu dieser Zeit wenig Wasser führende Saalebett mit. Natürlich war damals das gesamte Gembdental wenig bebaut und es gab kaum Hindernisse. Trotzdem ist das Vorgeschehene kaum vorstellbar, ist aber von glaubwürdiger Seite berichtet.
F. Dossin – nach Beilage Jenaer Volksblatt 1909
Zur Geschichte des Kloster- und später Rittergutes Wogau
Wogau als Ansammlung verschiedener Gehöfte und einer Grundbesitzverteilung gibt es in heutiger Form erst seit 1810. Vor dieser Zeit bestand ein Klostergut später Edelhof/Rittergut das den größten Teil der Flur Wogau sein Eigen nannte. Die Mühle Wogau mit ihrem Grundbesitz gehörte nicht zum Gut. Von diesen Anfängen bis Anfang des 30-jährigen Krieges (1618-48) gibt es noch geschichtlichen Aufarbeitungsbedarf. In der Zeit des 30-jährigen Krieges war der Geheime Rat und Oberaufseher zu Jena Bernhard Pflügk zum Posterstein Besitzer des Gutes. Im Jahre 1695 kauften es die damals noch minderjährigen Barone von Meuselbach, doch ging es bereits 2 Jahre später 1697 in den Besitz des Leutnants Friedrich Wilhelm von Rudolph, 1703 auf dessen Söhne Christian Friedrich und Georg Wilhelm über.
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts erwarben die Gebrüder von Schauroth das Rittergut, die es 1810 an die herzogliche Kammer zu Weimar gegen eine jährliche Leibrente von 400 Talern abtraten. Gleichzeitig traten sie auch die Wenigenjenaer Schenkgerechtigkeit die 1683 vom Herzog Ernst Johann dem Geheimrat Pflügk zum Posterstein wegen seiner um das Land erworbenen Verdienste verliehen worden war, und zwar, wie es im Schenkungsbrief vom 5. November 1683 heißt: “ für ihn seine Erben, Nachkommen und Inhaber des Gutes zu Wogau erb und eigentümlich.“
Die herzogliche Kammer verkaufte das Rittergut im Jahre 1810 an die Gemeinde Wogau für 8000 Taler. Das Gut wurde parzelliert und von den einzelnen ansässigen Familien erstanden. Heute sind diese Höfe in den Umrissen zum größten Teil erhalten aber durch Zukauf von Hofstätten und Grundbesitz gegenüber der damaligen Parzellierung sehr abweichend.
Nach Quellen „Altes und Neues aus der Heimat“
zusammengestellt u. ergänzt von F. Dossin